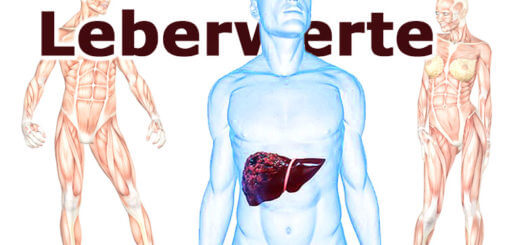Krank durch Medikamente – Welche Risiken Arzneimittel in sich bergen

Fotocredit: Evgeny Rannev | Fotolia + AdobeStock | AI
Gesundheitlichen Risiken und unerwünschten Wirkungen, die durch die Einnahme von Arzneimitteln entstehen können zählen bei vielen Patienten zu den großen Unbekannten. Aufklärung über Medikamentenrisiken tut Not.
Unerwünschte gesundheitliche Wirkungen von Arzneimitteln haben unterschiedliche Ursachen, dazu zählen Nebenwirkungen, Wechselwirkungen zwischen Medikamenten ebenso wie Probleme durch Polypharmazie und individuelle Unverträglichkeiten.
Risiken von Arzneimittel – Artikelübersicht:
- Medikamentenrisiken
- Nebenwirkungen
- Wechselwirkungen
- Allergien
- Polypharmazie
- Medikationsfehler
- Arzneimittelsicherheit
- Evidenzbasierte Medizin
- Die Rolle des mündigen Patienten
- Pharmakogenetik
- Linktipps
Das Thema “Krank durch Medikamente” ist komplex und erfordert ein Zusammenspiel von Ärzten, Apothekern, Patienten und Gesundheitssystemen, um die Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Arzneimitteltherapie zu gewährleisten.
Vor allem aber benötigt es zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit viel Aufklärungsarbeit um sowohl Ärzte als auch Patienten für dieses Thema weiter zu sensibilisieren.
1. Aufklärung über Medikamentenrisiken
Ein zentrales Thema im Umgang mit Medikamenten ist die Aufklärung über deren Risiken. Patienten sollten nicht nur über die Vorteile einer Behandlung informiert werden, sondern auch über mögliche Nebenwirkungen und unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW).
Eine umfassende Aufklärung hilft, das Bewusstsein für mögliche Gefahren zu schärfen und befähigt Patienten, informierte Entscheidungen über ihre Behandlung zu treffen.
2. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) und Nebenwirkungen
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) treten auf, wenn ein Medikament eine Wirkung hat, die nicht beabsichtigt ist. Diese können von milden Symptomen wie Übelkeit und Schwindel bis hin zu schweren, potenziell lebensbedrohlichen Reaktionen reichen.
Ein klassisches Beispiel für eine UAW ist die Allergie auf Penicillin oder abet auch auf bestimmte Kontrastmittel, die von Hautausschlägen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock reichen kann.
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen gehören zu den häufigsten Ursachen für Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, wobei sie in bis zu 10 % der Krankenhausaufnahmen involviert sind.¹
Nebenwirkungen sind eine Untergruppe der UAW und bezeichnen Effekte, die zwar unerwünscht, aber oft bekannt und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch akzeptabel sind. Ein Beispiel ist die Magenreizung durch nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen.
3. Wechselwirkungen zwischen Medikamenten
Wechselwirkungen treten auf, wenn zwei oder mehr Medikamente gleichzeitig eingenommen werden und sich gegenseitig in ihrer Wirkung beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können die Wirkung eines Medikaments verstärken, abschwächen oder unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen.
Beispielsweise kann die gleichzeitige Einnahme von Warfarin (einem Blutverdünner) und Aspirin das Risiko für Blutungen erheblich erhöhen.
Besonders gefährdet sind ältere Menschen, die oft mehrere Medikamente (Polypharmazie) einnehmen müssen. In solchen Fällen ist es besonders wichtig, alle Medikamente, einschließlich rezeptfreier Mittel und Nahrungsergänzungsmittel, im Auge zu behalten und mit dem Arzt abzustimmen, um gefährliche Wechselwirkungen zu vermeiden.
Polypharmazie erhöht das Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen signifikant und wird in bis zu 30 % der älteren Bevölkerung beobachtet.²
4. Allergien und Unverträglichkeiten
Allergische Reaktionen auf Medikamente sind eine weitere potenzielle Gefahr. Allergien entstehen, wenn das Immunsystem auf einen Arzneistoff überreagiert. Diese Reaktionen können harmlos, aber auch sehr schwerwiegend sein.
Häufige Symptome sind Hautausschläge, Juckreiz, Atemnot und in extremen Fällen ein anaphylaktischer Schock, der sofortige ärztliche Hilfe erfordert.
Unverträglichkeiten, die nicht allergisch bedingt sind, können ebenfalls problematisch sein. Beispielsweise leiden viele Menschen unter einer Unverträglichkeit gegenüber Lactose, die in einigen Medikamenten als Hilfsstoff enthalten sein kann.
5. Polypharmazie und ihre Risiken
Polypharmazie bezeichnet die gleichzeitige Einnahme von mehreren Medikamenten, was insbesondere bei älteren Menschen häufig vorkommt. Das Risiko für UAWs und Wechselwirkungen steigt mit der Anzahl der eingenommenen Medikamente.
Polypharmazie kann außerdem die Therapietreue beeinträchtigen, da es für Patienten schwierig sein kann, den Überblick über die Einnahmevorschriften zu behalten.
Eine Lösung für dieses Problem könnte die sogenannte „Deprescribing“-Strategie sein, bei der Ärzte gemeinsam mit den Patienten regelmäßig die Notwendigkeit jedes Medikaments überprüfen und gegebenenfalls nicht mehr benötigte Arzneimittel absetzen.
6. Medikationsfehler: Eine vermeidbare Gefahr
Medikationsfehler sind ein weiteres großes Problem im Gesundheitswesen. Diese Fehler können auf verschiedenen Ebenen passieren – bei der Verschreibung, der Herstellung, der Abgabe oder der Anwendung von Medikamenten.
Ein häufiges Beispiel ist das Verwechseln von Medikamenten aufgrund ähnlicher Namen oder Verpackungen.
Auch die Dosierung ist eine häufige Fehlerquelle. Zu hohe oder zu niedrige Dosen können die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen oder zu gefährlichen UAWs führen. Medikationsfehler sind oft vermeidbar und erfordern daher eine hohe Aufmerksamkeit seitens des medizinischen Fachpersonals und der Patienten.
7. Maßnahmen zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit
Um die Sicherheit im Umgang mit Medikamenten zu verbessern, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich. Eine zentrale Rolle spielt hier die Pharmakovigilanz – das systematische Überwachen der Sicherheit von Arzneimitteln nach ihrer Zulassung.
Hierzu gehören die Erfassung, Bewertung und Prävention von UAWs. Diese Informationen fließen in nationale und internationale Datenbanken ein, die wiederum helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schulung des medizinischen Personals in der sicheren Verschreibung und Anwendung von Medikamenten. Dies umfasst auch das Erkennen von Risikofaktoren für UAWs, wie etwa Vorerkrankungen, Allergien oder genetische Prädispositionen.
Auch die elektronische Patientenakte (ePA) kann zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit beitragen, indem sie Ärzten einen umfassenden Überblick über alle verschriebenen Medikamente und möglichen Wechselwirkungen bietet.
8. Evidenzbasierte Lösungsansätze für die klinische Praxis
Evidenzbasierte Medizin (EBM) spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Arzneimittelsicherheit. Dabei geht es darum, medizinische Entscheidungen auf der besten verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz zu basieren.
Dies erfordert, dass Ärzte und Apotheker stets auf dem neuesten Stand der Forschung sind und Behandlungsentscheidungen auf Basis von Studienergebnissen und Leitlinien treffen.
Ein vielversprechender Ansatz zur Minimierung von UAWs ist die Pharmakogenetik. Diese Wissenschaft untersucht, wie genetische Unterschiede zwischen Individuen die Wirkung von Medikamenten beeinflussen.
Dadurch könnte es möglich werden, Medikamente in Zukunft individuell anzupassen, um UAWs zu vermeiden und die Wirksamkeit zu optimieren. Beispielsweise können Patienten mit bestimmten genetischen Markern, die für langsamen Abbau eines Medikaments stehen, eine geringere Dosis benötigen, um Nebenwirkungen zu vermeiden.
9. Die Rolle des mündigen Patienten
Auch Patienten selbst können viel tun, um die Risiken bei der Einnahme von Medikamenten zu minimieren. Ein mündiger Patient ist gut informiert und aktiv an seiner eigenen Behandlung beteiligt. Dazu gehört:
Fragen stellen: Patienten sollten nicht zögern, ihren Arzt oder Apotheker nach den möglichen Nebenwirkungen eines Medikaments zu fragen, nach Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder auch nach nicht-medikamentösen Alternativen.
Eigenverantwortung: Patienten sollten stets darauf achten, die Dosierungsanweisungen genau zu befolgen und die Medikamente nicht eigenmächtig abzusetzen oder die Dosis zu verändern.
Offenheit gegenüber Ärzten: Es ist wichtig, dass Patienten ihre gesamte Medikation, einschließlich rezeptfreier Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, gegenüber dem behandelnden Arzt offenlegen, um mögliche Wechselwirkungen zu vermeiden.
Beobachtung: Patienten sollten ihre eigenen Reaktionen auf ein neues Medikament genau beobachten und bei ungewöhnlichen Symptomen sofort ihren Arzt konsultieren.
10. Pharmakogenetik zur Risikominimeirung von Arzneimitteln?
Pharmakogenetische Untersuchungen sind nicht neu und der Terminus „Pharmakogenetik“ wurde von dem Pharmazeuten Dr. Werner Kalow im Jahr 1962 zum ersten Mal erwähnt.
Die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre machte es möglich genetische Untersuchungen, die noch vor einigen Jahren Millionen Euro kosteten, mittleierweile schon um einige hundert Euro zu bekommen.
Damit ist ein solcher Test nun für viele Menschen leistbar geworden. AI unterstützte Plattformen erlauben es zudem die Unzahl von genetischen Informationen für den Arzt und letztlich den Patienten leicht verständlich nutzbar zu machen.
Ein solcher einmaliger genetischer Test im Bereich der Pharmakogenetik kann durchaus nützlich sein, sollte aber differenziert betrachtet werden:
Potenzielle Vorteile
- Die genetischen Informationen, die durch einen solchen Test gewonnen werden, bleiben ein Leben lang gültig, da sich die Gene nicht ändern. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse auch in Zukunft für Therapieentscheidungen herangezogen werden können.
- Personalisierte Medizin: Pharmakogenetische Tests ermöglichen eine individuellere Auswahl und Dosierung von Medikamenten basierend auf dem genetischen Profil des Patienten. Dies kann die Wirksamkeit der Behandlung verbessern und das Risiko von Nebenwirkungen reduzieren.
- Auch die Vermeidung von Nebenwirkungen kann ein entscheidender Vorteil sein, schließlich können in bestimmten Fällen schwere Nebenwirkungen durch die Identifizierung genetischer Varianten vermieden werden.
Einschränkungen und Bedenken
- Begrenzte Aussagekraft: Nicht alle Arzneimittelreaktionen sind ausschließlich genetisch bedingt. Faktoren wie Alter, Gewicht, Lebensstil und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
- Komplexität der Interpretation: Die Interpretation der Testergebnisse erfordert spezifisches Fachwissen. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse von erfahrenen Medizinern analysiert und in den klinischen Kontext eingeordnet werden.
- Von außerordentlicher Bedeutung sind in diesem Bereich natürlich ethische Überlegungen: Genetische Tests können sensible Informationen liefern, die über die unmittelbare Arzneimittelwirkung hinausgehen. Dies wirft Fragen zum Datenschutz und zur potenziellen Verwendung dieser Informationen auf.
Ein einmaliger pharmakogenetischer Test kann in Zukunft durchaus ein wertvolles Instrument zur Optimierung der Arzneimitteltherapie sein.
Er sollte jedoch als Teil eines umfassenderen medizinischen Ansatzes betrachtet werden und nicht als alleinige Grundlage für Therapieentscheidungen dienen.
Die Durchführung solcher Tests sollte in Übereinstimmung mit ethischen Richtlinien und unter Berücksichtigung der individuellen Patientensituation erfolgen. Patienten sollten vor der Durchführung eines solchen Tests umfassend über dessen Möglichkeiten und Grenzen aufgeklärt werden.
Fazit
Medikamente sind ein Segen für die moderne Medizin, bergen jedoch auch Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Durch eine bessere Aufklärung über Medikamentenrisiken, sorgfältige Verschreibung und Überwachung sowie durch die aktive Rolle des Patienten können viele dieser Risiken jedoch minimiert werden.
Evidenzbasierte Ansätze, wie die Pharmakogenetik, bieten vielversprechende Möglichkeiten für die Zukunft. Sie könnten helfen, die Arzneimitteltherapie noch sicherer und individueller zu gestalten. Letztendlich erfordert die Minimierung von Arzneimittelrisiken eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Apothekern und Patienten, basierend auf Wissen, Achtsamkeit und Verantwortung.
—–
Quellen:
¹ Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients (Pirmohamed M. in BMJ. 2004 Jul 3;329(7456):15-9.) DOI: 10.1136/bmj.329.7456.15.
² Clinical consequences of polypharmacy in elderly. (Maher, R. et al. in Expert Opinion in Drug Safety. 2014 Jan;13(1):57-65.) DOI: 10.1517/14740338.2013.827660.
³ DFP Literaturstudium: Krank durch Medikamente? Evidenzbasierte Lösungsansätze für die klinische Praxis (PDF)
Fotohinweis: sofern nicht extra anders angegeben, Fotocredit by Fotolia.com (bzw. Adobe Stock)
Linktipps
– Nebenwirkungen von Medikamenten
– Medizinisches Wörterbuch: die wichtigsten medizinischen Fachbegriffe
– Laborwerte – Gesundheit in Zahlen
– Schutz vor Nebenwirkungen von Antibiotika
– Medikamente richtig aufbewahren
– Psychopharmaka als Allheilmittel bei seelischen Problemen?
– Brauchen wir Nahrungsergänzungsmittel?


 (12 Bewertungen, Durchschnitt: 4,00 Sterne von 5)
(12 Bewertungen, Durchschnitt: 4,00 Sterne von 5)